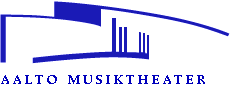Deconstructing Puccini
Musikalische Leitung: Stefan Soltesz - Inszenierung: Tilman Knabe - Bühnenbild: Alfred Peter - Kostüme: Kathi Maurer - Licht: Jürgen Nase - Choreinstudierung: Alexander Eberle - Dramaturgie: Nils Szczepanski - Fotos: Matthias Jung Chor, Extrachor und Kinderchor des Aalto-Theaters Essen Solisten (* Besetzung der Premiere) Giacomo Puccini hat der Nachwelt seine letzte Oper Turandot unvollendet hinterlassen – und damit gleich ein Rätsel aufgegeben: Wie muß das Fehlen der Schlußszene interpretiert werden? Als der im Laufe des Jahres an Kehlkopfkrebs erkrankte Komponist am 29. November 1924 an einer Herzattacke starb, war die Partitur bis zur Sterbeszene der Liú abgeschlossen. Puccini hatte mit seinen Librettisten Giuseppe Adami und Renato Simoni lange um eine endgültige Textfassung gerungen. Der Verlauf der Krankheit mag die abschließende Komposition letztenendes verhindert haben, ein grundsätzliches Unbehagen an der Handlung, das ist auch in Briefen dokumentiert, konnte Puccini wohl nicht ablegen. War sein gesamtes Werk zuvor durchzogen von der Gestalt der leidenden, opferbereiten Frau (von Manon Lescaut über die Mimí der Bohéme hin zur Butterfly, mit leicht anderer Grundierung auch die Tosca), so steht in Turandot ein anderer Typus auf der Bühne, der des eigenen Seelenheils wegen skrupellos andere - noch dazu die Guten - opfern läßt (nämlich die Dienerin Liú, eine Wesensverwandte der Butterfly). Puccini, der mit seinen todkranken Heldinnen litt, mag hier selbst moralische Skrupel angesichts des halbwegs glücklichen Märchenfinales aus Turandot verspürt haben – war das der entscheidende Grund, warum die Komposition nicht vorankam?  Erst einmal etwas Gruppensex, um das Publikum in Stimmung zu bringen: Man freut sich korpulierend auf die Hinrichtung des persischen Prinzen. Ping, Pang und Pong schmieden schon 'mal am Schwert.
Konsequent fortgedacht, stellt dieser Gedanke das Werk insgesamt in Frage. Wenn schon der Komponist dem Gedankengebäude seiner Oper mißtraut, dann muß diese als Ganzes auf den Prüfstand – das ist der Ansatz der Essener Neuinszenierung. Die fährt konsequent doppelgleisig, wobei dies, glaubt man den Beiträgen im Programmheft, von Beginn an so konzipiert war: Auf der einen Seite ist die Musik, vor allem das Orchester, das mit gewohnt hoher Disziplin außerordentlich schön Wohlklang verbreitet, sich flexibel der jeweiligen Situation anpaßt, die Dissonanzen und Modernismen nicht unterschlägt, Pentatonik und fernöstliche Klangfarben nicht als Exotismus, sondern als gestalterische Kompositionsmittel begreift und wunderbar kantabel die Sänger begleitet. Man kann die Partitur sicher mit mehr espressivo angehen als Stefan Soltesz, aber dessen sachliches Dirigat läßt ansonsten kaum Wünsche offen; hier und da könnten Gesangs- und Instrumentalstimmen noch besser "abgemischt" werden, über das richtige Tempo läßt sich im Detail streiten – aber das sind Kleinigkeiten. Auf der anderen Seite steht die Inszenierung von Tilman Knabe – und die erzählt eine völlig andere Geschichte. Mit Rückendeckung des Dirigenten. 
Weder der machtstrategisch ungeschickte Vater (links: Diogenes Randes als Timur) noch leichtbekleidete Schönheiten (Olga Mykytenko als Liú), schon gar nicht die Geister verstorbener bzw. gemeuchelter Prinzen, die beim Ratespiel versagt haben (in Blut getaucht: etliche Statisten) können Kalaf (Dario Volonté) davon abhalten, anderthalb Akte später die berühmte Arie "Nessun dorma" zu singen. Und dafür muss er ja vorher die Rätsel der Turandot lösen.
Schmierenkomödie Knabe siedelt die Handlung in einem modernen und totalitären asiatischen Staat an, das weltabgeschottete Nordkorea liegt hier wohl gedanklich näher als China. Eine Militärjunta beherrscht mit Maschinenpistolen das Land, die „Halle des Volkes“ ist über den Rohbau offenbar nicht hinausgekommen. Staatsführer Altoum hängt, ganz wörtlich zu nehmen, am (medizinischen) Tropf. Kalaf ist ein Revolutionär in Turnschuhen, dem das Volk bald zujubelt. So weit, so gut und so schlicht: Mag ja alles stimmen, aber neue Impulse bringt das allein nicht. Also geht Tilman Knabe zwei Schritte weiter. Zuerst dreht er die emotional-erotische Konstellation um: Dienerin Liú ist die attraktive, Prinzessin Turandot die häßliche Frau. Was aber unerheblich ist, denn Kalaf lässt Liú unbeeindruckt an seinem Hosenstall herumnesteln und vergewaltigt Turandot im Finale gelangweilt und geschäftsmäßig. Er interessiert sich nur für die Macht, und der Schlüssel dazu ist der Sieg über Turandot. Dazu geht er über Leichen: Er reicht Liú die Pistole, mit der sie sich prompt gehorsam erschießt. Jede Revolution braucht ihre Märtyrer, das hat Kalaf erkannt, und Liú – von Puccini mit der passenden Musik ausgestattet – eignet sich dafür ganz hervorragend. So wird Puccinis letzte Oper zu einer Schmierenkomödie der billigen, kalkuliert komponierten Gefühle. Provakation auf mittlerem Niveau Dieses Konzept mutet dem Publikum einiges zu, und das kann man positiv wie negativ sehen. Natürlich hält Puccinis Oper die Zerreißprobe aus, und der mündige Zuschauer/Zuhörer hat die Möglichkeit, aus dem ungleichen Nebeneinander von Musik und Szene anregende Schlüsse zu ziehen. Auch gedanklich ist vieles plausibel (wobei auch der gegenteilige Ansatz erlaubt ist: Besteht nicht gerade der Reiz – und der fortschrittliche Aspekt – der Turandot darin, daß hier ein affirmativer Liebes-Schluß ohne Rücksicht auf das konventionelle Moral- und Opernschema und mit allen Widersprüchen durchgesetzt wird?). Nur: So ganz taufrisch ist dieser antispießbürgerliche Ansatz, dem Publikum die ungetrübte Freude auszutreiben, ja nicht. Und wer Turandot auf das Programm setzt, müßte ja auch genug Gründe parat haben, warum gerade diese Oper gespielt wird. An dieser Stelle ist Knabes Ansatz reichlich eindimensional. Es gibt andere Regisseure, die, gerade auch in Essen, auf gedanklich höherem Niveau provoziert haben – zu nennen wären hier Peter Konwitschny, Dietrich Hilsdorf oder zuletzt Brian Kosky. .jpg) Auch die Generalität ist sich nicht zu schade, an der Mülltrennung mitzuwirken. Meistens müssen, sofern sie nicht verspeist werden, Leichen entsorgt werden. Man sieht (von links) Pang (Albrecht Kludszuweit), Ping (Heiko Trinsinger) und Pong (Andreas Hermann) bei der Arbeit.
Abgeschaut
Bei Dietrich Hilsdorf scheint sich Tilman Knabe einiges abgeschaut zu haben. Vor allem im Finale: Da treten die Chormassen in den Zuschauerraum, und wir alle sind es, die da unkritisch jubeln, während von den Rängen Konfetti fällt. Das hatte Hilsdorf schon 1988 in Don Carlos ganz ähnlich vorgeführt. Und auch Hilsdorfs antikatholische Attitüde wird zitiert: Hier wird die tote Liú zur Marienfigur ausstaffiert, mit blauem Leichensack als Mantel (daß in diesen fernöstlichen Gefilden plötzlich ein pseudochristlicher Marienkult einsetzen soll, ist wohl weniger einer regieimmanenten Logik als der puren Lust an der Provokation geschuldet). Von Filmregisseur Volker Schlöndorff könnte die Idee entlehnt sein, den Leichnam des hingerichteten Prinzen von Persien vom Volk aufessen zu lassen (in Schlöndorffs Film Die Geschichte der Dienerin gibt es eine ähnliche Szene). 
Wie, den Blödmann in Turnschuhen soll ich heiraten, Papi? Turandot (Iréne Theorin), erbost, und Altoum (Werner Sindemann), kränklich.
Es soll nicht unterschlagen werden, daß es ein paar eindrucksvolle Momente gibt. Dazu gehört das Bühnenbild (Alfred Peter) mit seiner unbarmherzigen Betonlandschaft, weniger die allzu plakativen Kostüme (Kathi Maurer). Immerhin bleibt Knabe insoweit werktreu, als er gerne dekorative Arrangements auf der Bühne stellt (einen großen Opernchor so zu führen, daß die Riesenbühne in Essen leidlich gefüllt aussieht, gelingt ihm trotzdem nicht). Hübsch gelöst ist der Übergang von Liús Sterbeszene zum Finale: Da parlieren Ping, Pang und Pong (hier allesamt Generäle) in munterem Italienisch darüber, was nun, wo der Komponist gestorben sei, zu geschehen habe – welcher Schluß gespielt werden solle usw. Irgendwann darf Dirigent Stefan Soltesz despotisch eingreifen: „Was hier gespielt wird, bestimme immer noch ich“ (nach allem, was man aus Essen so hört, ein sehr wahrer Satz). Es wird dann die inzwischen sehr umstrittene Fassung von Franco Alfano, die schon Toscanini verwendete, gespielt (allerdings gekürzt). Dazu darf Kalaf im Anzug Turandot vergewaltigen, wozu Ping, Pang und Pong „Bravo“ rufen. Was naturgemäß den einen oder anderen Zuschauer zu einem „Buh“ animiert, vom Regisseur ganz sicher fein einkalkuliert. Immerhin hübsch, daß Bravi wie Buhs auf einen Wink eines der Generäle verstummen – da wirken die Mechanismen der Diktatur bis in den Zuschauerraum hinein. Kurz: Hier ist, leicht durchschaubar, Publikumsärgern angesagt. Wenn es sich denn ärgern läßt: Am Ende gibt es für den Regisseur in der Summe fast mehr „Bravo“ als „Buh“, was für einen Berufsprovokateur wie Tilman Knabe einer Niederlage gleich kommen dürfte.  Und das soll meine Oper sein? schreit Turandot (Iréne Theorin) hier im Finale natürlich nicht. Etwas mehr von der Regie zugelassenes Liebesglück hätten ihre Stimmung aber sicher aufhellen können.
Stimmlich solide
Ach ja, gesungen wurde auch. Von Dario Volonté würde man sich zwar noch mehr Glanz und auch Volumen wünschen, aber insgesamt bewältigt er die Partie des Kalaf einigermaßen klangschön, mit sauberer Stimmführung und durchdachter Disposition – und er singt auch da noch, wo mancher Kollege in dieser Rolle nur noch schreit. Schade, daß er einen so unsympathischen Prinzen spielen muß. Iréne Theorin ist eine Turandot von walkürenhafter Erscheinung, gestaltet die Partie mit kontrollierter und höhensicherer Stimme, irgendwie unbestimmt schön, aber etwas neutral im Ausdruck. Oder liegt es an der übermächtig dekonstruierenden Regie, daß kaum Emotionen aufkommen? Die Liù ist sicher die dankbarste Partie der Oper, von Olga Mykytenko tadellos gesungen, über alle Register mit substanzvollem Piano und schönem Legato. Auch hier bleibt aber eine gewisse Distanz zur Figur. Die anderen Rollen sind solide besetzt, keine Ausfälle, aber auch keine Glanzpunkte. Sehr hübsch und akkurat singt der Kinderchor; dagegen verlieren sich Chor und Extrachor, obwohl aufmerksam und präzise, auf der großen Bühne auch akustisch, wirken oft klanglich zu wenig präsent, etwas blaß im Piano. Im Zuschauerraum positioniert, klingt das ungleich besser. So hat der Aufmarsch zum Finale wenigstens akustisch etwas Versöhnliches. Ein belehrender Abend, aus dem wir nach Hause tragen, dass Turandot trotz schöner Musik eigentlich eine blöde Oper ist. Bitte an den richtigen Stellen „Buh“ rufen, sonst funktioniert die Inszenierung nicht. Weitere Informationen erhalten Sie vom Theater Essen |
Deconstructing Puccini
Tilman Knabe inszeniert in Essen "Turandot" mit Folter, Selbstmord, Kannibalismus, Vergewaltigung und Gruppensex
von Stefan Schmöe

Musiktheater
24.09.07