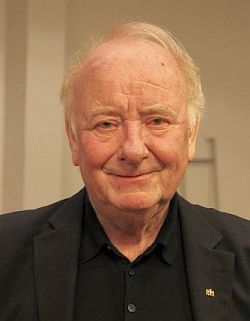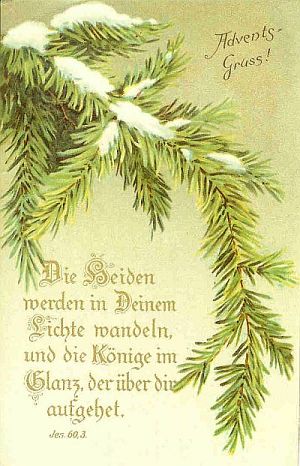Wie viele Tage zählt der Advent?
Altehrwürdige Terminierung
des noch immer gültigen Festkalenders
Von Heinz Rölleke
Die Zahl VIERZIG spielt in allen Kulturen zu allen Zeiten eine besondere und immer eine fast gleichbedeutende Rolle, so auch in jüdischen wie in christlichen Überlieferungen und Traditionen. Sie ist für die Terminierung der alljährlichen Adventszeit von Bedeutung, was heute auf den ersten Blick allerdings nicht mehr ohne weiteres erkennbar ist.
Die Herleitung soll mit einigen Beispielen der Erscheinungen der Zahl Vierzig im Alten und im Neuen Testament begonnen werden.
40 Jahre zog Israel durch die Wüste
40 Tage durchstreiften Kundschafter das erreichte Gelobte Land
40 Jahre zählte Isaac, als er um Rebecca freien durfte
40 Tage stieg das Wasser der Sintflut
40 Ellen hoch stand dieses Wasser, ehe es wieder fiel
40 Tage weilte Moses auf dem Sinai
40 Tage lang zog der Prophet Elias bis zum Berg Horeb
40 Tage Zeit waren Ninive zur Buße zugemessen
Von Jesus heißt es im Neuen Testament, daß er sich vor seinem ersten öffentlichen Auftreten in die Wüste zurückgezogen hatte, wo er „vierzig Tage und vierzig Nächte fastete“ (Matth. 4.2). Genau diese Frist hat Goethe ganz allgemein als die Zeitspanne der Zurückgezogenheit und des sich Vorbereitens gedeutet. Eine solche Zeit durchlebt jeder Mensch in den 40 Wochen der Schwangerschaft seiner Mutter, wie es Walther von der Vogelweide Anfang des 13. Jahrhunderts im Blick auf die Schwangerschaft Marias und die Menschwerdung Christi festgehalten hat: „Er was in einer reinen megede klûs wol vierzec wochen und nicht mê“ (Jesus weilte vierzig Wochen wie in einer reinen Klause im Leib seiner jungfräulichen Mutter Maria und nicht einen Tag mehr). Diese beiden mit Christus verbundenen Zahlen haben schon die frühen Christen mit weiteren über die Vierzig errechneten Zeitspannen im Lebenslauf des Gottessohns zu ergänzen versucht, um sie in das Andachtswesen und in den liturgischen Ablauf des Kirchenjahres einzusetzen. So ging man von der Zeit zwischen Weihnachten und Mariae Lichtmeß von der jüdischen Tradition aus, daß Knaben 40 Tage nach der Geburt in den Tempel gebracht wurden; sodann rechnete man für die Zeit des öffentlichen Wirkens Jesu vierzig Monate, für die Zeit seiner Grabesruhe 40 Stunden (danach das seit dem 10. Jahrhundert und bis heute gefeierte vierzigstündige Gebet in der Karwoche).
Konnte man bei der kalendarischen Fixierung der beiden höchsten Feste Ostern und Pfingsten auf die Daten zurückgreifen, die für Passah und Schawuot gelten, so war die Plazierung der Feier der Himmelfahrt Jesu ausschließlich christlich bestimmt. Man ging von den Worten Jesu in seinen Abschiedsreden (Joh. 14.12-14)aus: „Ich gehe zum Vater“ (mit meiner Himmelfahrt), und „mein Vater wird euch den Geist der Wahrheit senden“ (an Pfingsten). Also legte man die Feier der Himmelfahrt Christi auf einen Termin zwischen Ostern und Pfingsten, wobei auch eine mathematische Rechnung Berücksichtigung fand. Pfingsten wird immer - gemäß der Festbezeichnung (pentecosté) - am 50. nachösterlichen Tag gefeiert, Christi Himmelfahrt am 40. Tag nach Ostern. Mit der Rückkehr Christi zu seinem Vater war die Verheißung der Sendung des Heiligen Geistes verknüpft. Die Teiler der Zahl 40 ergeben addiert die Summe 50 (1+2+4+5+8+10+20: In der Zahl der Himmelfahrt liegt die Pfingstzahl verborgen).
Auf ganz sicherem Boden stand man natürlich mit der genauen biblischen Angabe des 40-tägigen Fastens Jesu in der Wüste. Diese sozusagen geheiligte Frist wurde nun auch wie selbstverständlich für die Fasten- und die Exerzitienübungen der Christen übernommen. Die Fastenzeit vor Ostern beginnt am Aschermittwoch und endet nach 46 Tagen am Ostertag. An den sechs Fastensonntagen galten die Speisevorschriften nicht; damit ergibt sich alljährlich die Dauer von 40 Fasttagen.
Damit zur im Thema gestellten Frage. Nach dem Muster der klassischen Fastenzeit vor Ostern wurde auch das Adventsfasten vor Weihnachten mit 40 Tagen angesetzt, wobei zu bedenken ist, daß man in den ersten Jahrhunderten n. Chr. in vielen Bistümern den Festtag Epiphanias (6. Januar) als Geburts- und Erscheinungsfest des Erlösers beging. Als eigentliche Adventszeit rechnete man später die Zeit vom Samstag vor dem ersten Adventssonntag bis Weihnachten, so daß sie maximal 28 Tage währt. Im Blick auf die alte Datierung des Festes muß man die 12 Tage vom 25. Dezember bis zum 6. Januar hinzuzählen, um wieder auf die geheiligte Frist von 40 Tagen und damit wieder auf die intendierte Zahl 40 zu kommen. Auf die Heilige Zahl Vierzig brachte es die Adventsfastenzeit auch zeitweise dadurch, daß man diese am 25. November, dem Tag der Heiligen Katharina, beginnen und am 6. Januar enden ließ, wovon noch der Volksreim „Sankt Kathrein stellt's Tanzen ein“ Zeugnis gibt (das Tanzen war in jeder Fastenzeit streng untersagt).
Der Kalender für das Jahr 2022 weist eine Adventszeit vom 27. November bis 24. Dezember aus (also von 27 oder - nach Abzug der vier fastenfreien Sonntage - 23 Tagen).Würde man wie einst die 13 Tage bis Epiphanias am 6. Januar 2023 hinzurechnen, käme man wieder auf die altehrwürdige Zahl 40. Indes leben wir in einem Zeitalter der Säkularisierung, und man gibt sich mit der in dieser Hinsicht nichtssagenden Anzahl der wenigen adventlichen Tage zufrieden.
Dennoch erscheint vielen Menschen die vorweihnachtliche Adventszeit so ausgedehnt oder auf Dauer langweilig wie noch nie: In Kaufläden und Märkten werden zuweilen schon ab Oktober Weihnachtsbäume sowie adventliche Requisiten und Kostbarkeiten geradezu inflationär angeboten. Den Kindern, die von der Bedeutung der Advents- und auch immer häufiger des Weihnachtsfestes nichts mehr wissen, geht dabei erkennbar vieles verloren: In einem Vierteljahr, das von einem zunehmenden Weihnachtsrummel geprägt ist, ebnen sich die wunderbaren Feste dieser Zeit Sankt Martin, Sankt Nikolaus und das Geburtsfest des göttlichen Jesuskindes spürbar ein. Im Jahresablauf haben uralte und tiefsinnige Fest- und Gedenktage an Bedeutung verloren. Das Leben nicht nur der Kinder ist ärmer geworden.
© Heinz Rölleke für die Musenblätter 2022
|
Wie viele Tage zählt der Advent?
Altehrwürdige Terminierung des noch immer gültigen Festkalenders
von Heinz Rölleke

Vermischtes
27.11.22